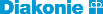Asset Publisher
Asset Publisher
Fraueninformationszentrum des Vereins für Internationale Jugendarbeit
Wir, das Fraueninformationszentrum (FIZ), sind eine Fachberatungsstelle in Stuttgart für migrierte und geflüchtete Frauen sowie für Opfer von Menschenhandel. Wir beraten und begleiten unsere Klient*innen, die geschlechtsspezifische Verfolgung, Gewalt, Ausbeutung erlebt haben oder von Menschenhandel betroffen sind.
| Empowerment lässt Menschen ihre eigenen Kräfte erkennen und einsetzen. Empowerment kann nicht von außen entstehen, lediglich angeregt und gefördert werden. Wir als Organisation können Räume und Bedingungen schaffen, in denen die Menschen sich selbst ermächtigen und sich selbst befähigen können. |
In unserem Empowerment-Projekt werden Betroffene von Menschenhandel als Ehrenamtliche gewonnen und als Multiplikatorinnen qualifiziert. Durch ihre Erfahrungen können sie andere Geflüchtete niederschwellig im Alltag unterstützen.
Im FIZ bieten wir Raum, damit sich geflüchtete Frauen selbst empowern können. Die Multiplikatorinnen setzen ihre Erfahrungen und ihre Lebensweltexpertise vielfältig ein. Sie ermutigen andere Geflüchtete, für ihre Rechte einzustehen, informieren über bürokratische sowie Verwaltungsabläufe, begleiten zu wichtigen Terminen und werden durch wissenschaftliche oder mediale Interviews politisch aktiv. So werden aus Opfern, die fremdbestimmt waren, selbstbestimmte Aktivistinnen.
Als Koordinatorinnen des Multiplikatorinnen-Projekts sind für uns Partizipation und (Mit-)Gestaltung der Aktivistinnen leitend. So wird ihre Selbstwirksamkeit gestärkt. In der Projektumsetzung zeigt sich, dass dies viel Zeit und Beziehungs-/Vertrauensarbeit erfordert. Der Gewinn ist, dass die Projektarbeit so in vielen kleinen Schritten angepasst und weiterentwickelt wird.
| Gruppentreffen der Multiplikatorinnen In den Multiplikatorinnen-Treffen erleben wir starke Frauen, die trotz oder vielleicht wegen ihrer Lebenserfahrungen eine große Kraft ausstrahlen. Es ist eine vielfältige Gruppe, in der wir einen Zusammenhalt zwischen den Frauen spüren. Die Treffen können unterschiedlich sein, mal leise, mal temperamentvoller, mal werden fachliche Themen besprochen, mal sehr persönliche. Wir FIZ-Mitarbeiterinnen versuchen einen möglichst offenen Raum zu gestalten, in dem die Frauen ihre Anliegen einbringen und besprechen können. |
Was sich durch die Pandemie geändert hat:
Beratungstermine finden seit der Pandemie nur noch bedingt in der Beratungsstelle statt. Oftmals weichen wir auf telefonische oder Video-Beratung aus. Unsere Gruppentreffen halten wir nur noch digital ab. Es hat einige Zeit gebraucht, bis alle Teilnehmerinnen die technischen Hürden nehmen konnten. Inzwischen werden diese Angebote gerne angenommen, da es eine wohltuende Abwechslung zum Alltag ist.
Was wir noch vorhaben:
Gerne würden wir noch weitere Multiplikatorinnen-Gruppen gründen. Multiplikatorinnen aus der ersten Gruppe haben 2019 maßgeblich bei der Weiterbildung einer zweiten Gruppe mitgewirkt und nehmen wichtige Rollen in der Weiterentwicklung des Angebots ein.
Perspektivisch wird angestrebt, dass Multiplikatorinnen sich professionalisieren und Teil unseres Teams werden können. Ebenso würden wir gerne die Kapazitäten unseres Beratungsangebots weiter ausbauen, so dass alle Ratsuchenden Beratung bei uns erhalten können.

Weitere Informationen:
 Asset Publisher
Asset Publisher
„Zugänge gestalten, Teilhabe einfordern“ - Verbändeübergreifende Veranstaltungsreihe zum Empowerment geflüchteter Frauen in 2021
Die mehrteilige Online-Veranstaltung 2021 im Rahmen des Projekts „Empowerment geflüchteter Frauen“ stand unter dem Titel „Zugänge gestalten, Teilhabe einfordern“.[1] Empowerment hat zum Ziel, Menschen in ihrer Selbstbestimmung und Teilhabe zu stärken. Aber wie kann Projektarbeit ganz konkret Zugänge gestalten und die Zielgruppe beim Einfordern von Teilhabe unterstützen? Die Mitarbeitenden der Empowerment-Projekte wurden dazu eingeladen, ihre Projektarbeit unter dem Fokus der digitalen, gesundheitlichen und sozialen Teilhabe zu beleuchten und Ideen sowie Anregungen für ihre Arbeit zu entwickeln. Die Veranstaltung wurde ausgerichtet von dem Bundesverband der Arbeiterwohlfahrt, dem Deutschen Caritasverband, der Diakonie Deutschland, dem Deutschen Roten Kreuz und der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland und fand im Rahmen des Projekts „Empowerment geflüchteter Frauen und anderer besonders schutzbedürftiger Personen“ statt, gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration. 
1. Teil: „Digitale Teilhabe“
Die Veranstaltungsreihe startete im Juni mit dem Thema „Digitale Teilhabe“. Der digitale Raum ist in den vergangenen Jahren zu einem immer wichtigeren Ort für gesellschaftliche Auseinandersetzung, Teilhabe und für den Zugang zu Informationen geworden. Sicherheit im Umgang mit digitalen Endgeräten, gängiger Software und Online-Plattformen sind oft unerlässlich für Ausbildung, Arbeitsmarktzugang oder auch die Terminbuchung bei Behörden oder Regeldiensten. Gerade in der Pandemie mit der Umwandlung vieler Angebote in Online-Formate hat sich dies gezeigt und verstärkt. Ziel der Veranstaltung war es, auf die damit verbundenen Chancen und Herausforderungen für geflüchtete Frauen einzugehen und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie digitale Teilhabe in der Projektarbeit gefördert werden kann.
Dazu wurde das Projekt „Digital Empowerment and information access for refugee women“[2] des FrauenComputerZentrumsBerlin e.V. (FCZB) von der Projektleiterin Elisa Marchese vorgestellt. In dem Projekt werden geflüchtete Frauen durch ein offenes IT- und Medienkompetenz-Training dabei unterstützt, ihre Mobilität im digitalen Raum und ihre Zugänge zu digitalen Medien zu verbessern. Der niedrigschwellige Ansatz des Projekts sowie die Orientierung an den Interessen, Kenntnissen und individuellen Bedürfnissen der geflüchteten Frauen haben sich dabei als wichtige Erfolgsfaktoren für die gelingende Projektarbeit erwiesen. Gleichzeitig ergeben sich aber auch Hindernisse und Herausforderungen, wie beispielsweise die unterschiedliche technische Ausstattung und Internetkapazitäten der Teilnehmerinnen, die digitalen Vorkenntnisse, die beschränkten zeitlichen Verfügbarkeiten, sowie Sprachbarrieren. Zur Überwindung dieser Hindernisse ist eine flexible Anpassung der Lernsettings an die zeitlichen und räumlichen Kapazitäten der Teilnehmerinnen von großer Bedeutung. Auch begleitende Kinderbetreuung und Sprachmittlung in Gemeinschaftsunterkünften haben sich als hilfreich erwiesen, um die Lernsituation der Teilnehmerinnen zu verbessern.
In der anschließenden Diskussion wurde deutlich, dass die Projektmitarbeitenden bei der Umsetzung von digitalen Angeboten in ihren Projekten mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert sind. Besonders die geringe Verfügbarkeit von Hardware und Internetkapazitäten, sowie sprachliche Hürden und fehlende IT-Kompetenzen machen es schwierig, die Frauen mit digitalen Angeboten zu erreichen. Gleichzeitig haben sich einige Angebote, wie z.B. digitale Treffen über Videotools oder Kommunikation über Messenger-Dienste in der Pandemie auch als Chance erwiesen, um die Zielgruppen trotz Kontaktbeschränkungen zu erreichen und Teilhabe zu ermöglichen.
2. Teil: „Gesundheitliche Teilhabe“
Der mittlere Teil der Veranstaltungsreihe richtete den Fokus auf Gesundheit als einen zentralen und sehr aktuellen Aspekt von Teilhabe. Ausgehend von einem Input durch Marcus Wächter-Raquet von der Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen e.V. wurde das Konzept der Gesundheitsförderung eingeführt, um im Anschluss zwei Praxisprojekte als beispielhafte Blitzlichter für gute Projektarbeit zur Gesundheitsförderung mit geflüchteten Frauen vorzustellen. Svenja Reimann vom Lore-Agnes-Haus Essen stellte hierfür Ressourcen- und Stabilisierungsgruppen für Frauen, die psychisch belastende Erfahrungen gemacht haben, vor. Anschließend stellte Djamila Amrani von der Beratungsstelle Myriam des Frauenwerks der Nordkirche das Biografieprojekt mit geflüchteten Frauen vor und führte in die Methoden der kultursensiblen Biografiearbeit ein.[3]
Gesundheitliche Teilhabe kann auf verschiedenen Ebenen gefördert oder behindert werden, von individuellen Lebensweisen über soziale Netzwerke und Lebensbedingungen hin zu Umweltfaktoren. Der Zugang geflüchteter Menschen zu gesundheitlicher Teilhabe wird in der Anfangszeit in Deutschland von spezifischen Bedingungen, wie den Lebensbedingungen in zugewiesenen Unterkünften, nach dem AsylbLG eingeschränkten (Gesundheits-)Leistungen oder auch noch kleinen sozialen Netzwerken am neuen Wohnort geprägt. Projektarbeit zur Gesundheitsförderung kann zum einen geflüchtete Menschen bei der Stärkung ihrer Gesundheitsressourcen unterstützen und zum anderen an der Schaffung gesundheitsfördernder Strukturen und Lebensbedingungen mitwirken. Ein wichtiger Aspekt in beiden Ansätzen ist die Partizipation der Betroffenen selbst. Sie kennen ihre Lebensbedingungen am besten, können Veränderungen nachhaltig bewirken und sich selbst dabei als Handelnde und Wirkende erleben.[4]
Methoden zur gesundheitsfördernden Projektarbeit sind u.a. körperbezogene Arbeit, Kreatives oder Biografiearbeit. Vorgestellte Beispiele reichten von Händeyoga, Ressourcenkisten, Body 2 Brain CCM® und Achtsamkeit hin zu Identitätsmolekülen und der „Geschichte meines Namens“. Wichtig ist dabei, Methoden nicht nur zu nutzen, sondern sich – besonders bei Biografiearbeit – mit ihnen auseinanderzusetzen und eine Haltung zu entwickeln, die Grundsätze wie Freiwilligkeit, Wertfreiheit, das Recht zu Schweigen und den Fokus auf die erzählende Person verinnerlicht.[5]
3. Teil: „Soziale Teilhabe“
Thema der dritten Veranstaltungsreihe war „Soziale Teilhabe“. Um Raum für den gemeinsamen (Praxis-)Austausch zu geben, lag der Fokus darauf, die eigenen Projekterfahrungen als Ausgangspunkt zu nehmen und gemeinsam herauszuarbeiten, wo Soziale Teilhabe möglich ist und wie sie nachhaltig gestaltet werden kann. Ein Einführungsvideo zum Thema Sozialraumorientierung und die Ergebnisse einer digitalen Umfrage schafften dafür eine gemeinsame Wissensbasis. Mitbestimmung, Gleichberechtigung, Gemeinschaft, Zugang zu Leistungen und Wissen, Verantwortung, finanzielle Mittel usw. sind zentrale Begriffe, wenn es um Soziale Teilhabe geht. Ziel ist es, geflüchtete Menschen vor Isolierung und Benachteiligung zu schützen und sie bestmöglich durch ressourcenorientierte, sozialpädagogische Angebote im Hinblick auf soziale, politische, kulturelle und berufliche Teilhabe zu unterstützen.
Die Gruppenarbeiten im Welt-Café zeigten, dass die Projektmitarbeitenden mit ihren Maßnahmen ein breites Spektrum abdecken: Von der (digitalen) sprachlichen Förderung, über Freizeitaktivitäten, Informationsveranstaltungen und vielem mehr. Um nachhaltige Wirkungen bei der Zielgruppe erzielen zu können und ihre Partizipationschancen zu steigern, arbeiten sie nicht nur auf individueller Ebene im Sinne von Einzel- oder auch Gruppenberatung, sondern versuchen ihr Klientel sowohl in der Nachbarschaft als auch in allen relevanten Einrichtungen im Sozialraum im Kleinen und der Gesellschaft im Großen anzubinden. Damit diese Arbeit nachhaltig gelingen kann, sind die Projektmitarbeitenden jedoch von zeitlichen, finanziellen und personellen Ressourcen abhängig, sowie von politischen und sozialen Gegebenheiten, die strukturell ein Mehr oder Weniger an Partizipation ermöglicht. Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, ergibt sich ein großes Potenzial an Möglichkeiten der Förderung sozialer Teilhabe, die nur darauf warten, mit Energie und Lust angegangen zu werden.
Die Veranstaltungsreihe wurde gefördert durch:
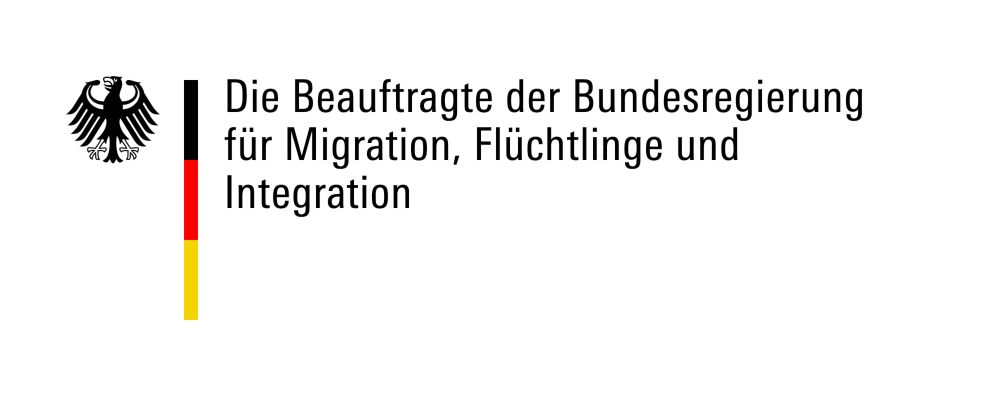
[1] Dokumentation der Online-Veranstaltungsreihe in 2020 im Projekt „Empowerment geflüchteter Frauen“: https://www.awo.org/sites/default/files/2021-05/DokumVeranst2020_Empowerment_final_0.pdf
[2] Das Projekt DIGITAL EMPOWERMENT AND INFORMATION ACCESS FOR REFUGEE WOMEN des FrauenComputerZentrumsBerlin e.V. wird gefördert aus Mitteln der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung, Abteilung Frauen und Gleichstellung. In der Veranstaltung wurde es als Best Practice Beispiel vorgestellt.
[3] Dieses Projekt wurde in Kooperation mit dem Asylzentrum Tübingen e.V., der Mitternachtsmission Fachberatungsstelle für Betroffene von Menschenhandel in Heilbronn sowie mit SOLWODI Fachberatungsstelle in Fulda durchgeführt und durch die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration gefördert.
[4] Dieser Absatz basiert auf einer Mitschrift des Inputs von Marcus Wächter-Raquet von der Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen e.V., sowie der Publikation „Gesundheitsförderung bei Geflüchteten. Lücken schließen – Angebote erkennen“ des Kooperationsverbundes Gesundheitliche Chancengleichheit (Download PDF: https://www.gesundheitbb.de/fileadmin/user_upload/21-02_Handreichung_Gesundheitsfoerderung_mit_Geflu__chteten.pdf )
[5] Dieser Absatz basiert auf einer Mitschrift aus den Kurzinputs von Djamila Amrani (Myriam, Frauenwerk Nordkirche) und Svenja Reimann (Lore-Agnes-Haus).